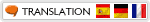
|
|
 Opel
Diplomat CD Coupé (1970)
Opel
Diplomat CD Coupé (1970)Opel Diplomat Frua CD, Opel Gran Turismo HS V8
Nach dem großen Erfolg des auf der 42. IAA 1965 vorgestellten und ab 12.9.1968 produzierten Sportwagens Opel GT wurden Ende 1968 bei Opel unter dem Projektnamen Astra (Griffith 1993) mit den Arbeiten an einem Gran Turismo begonnen.
11.–21.9.1969 Ausstellung der Stylingstudie Opel
CD (Coupé Diplomat) auf dem Opel-Stand bei der
44. Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt/Main (D);
Pietro Frua zeigt auf einem Nachbarstand sein Diplomat
Coupé Spezial auf Basis des Opel Admiral B
Design: Charles
M. „Chuck“ Jordan (Opel Designchef 1967–1971 und späterer
Vize-Präsident von GM) und seine Assistenten George A. Gallion, David R.
„Dave“ Holls, Herbert Killmer und Hideo Kodama (Hrachowy
2000); laut Stange (persönliche
Mitteilung 6/2002) war auch Erhard Schnell (Leiter des Opel Designstudios
3 für Advanced Design seit 1964) beteiligt. Die Heckansicht ist durch
einen Entwurf von Erhard Schnell für den Opel Aero GT von 1969 inspiriert
(Henrion
& Müller 1997).
Merkmale: Fiberglas-Karosserie auf um 30,5 cm verkürzter Bodengruppe
(Radstand 2.540 mm; Hrachowy
2000) des Opel Diplomat B; statt Türen eine zur Demonstartion
des Innenraums teilweise abnehmbare Glaskuppel; Front und Seitenscheiben
in Kuppel bündig eingeklebt; Leichtmetallräder 7 J x 15; Cockpit mit
verstellbarer Lenksäule und daran frei aufgehängtem Instrumententräger,
einstellbare Pedale, Mittelkonsole mit Telefonattrappe
Laut Karl-Heinz Wedel (persönliche Mitteilung 15.5.2002; zitiert auch von
Lichtenstein
2001) handelt es sich nur um eine rollfähige Maquette und nicht –
wie von Hübner (1987)
angegeben – um ein voll fahrbereites Auto. Bei dem von Hübner
(1982, 1987)
Ende 1971 angeblich oft auf dem Weg
zwischen Charles Jordans Wohnsitz Falkenstein im Taunus (und nicht
Königstein, wie von Hübner angegeben) und Rüsselsheim gesichteten Fahrzeug
kann es sich höchstens um den silbernen
Frua-Prototypen gehandelt haben. Die Maquette befindet sich noch -
Rot metallic lackiert – im Besitz von Opel.
Daneben wurde ein auch als Sitzbock (engl. „sitting buck“) bezeichnetes, (bedingt) fahrbereites Funktionsmodell gebaut, das anstelle der Außenhaut nur mit Metallrohrstäben angedeutete Außenlinien hatte. Bei diesem konnte die Glaskuppel mit den Türauschnitten hydraulisch nach oben geschwenkt werden, wie bei der unter der Verantwortung von General Motors Styling-Chef William „Bill“ Mitchell und dem Leiter von Chevrolet Styling (und Vorgänger von Chuck Jordan als Designchef bei Opel) Clare M. MacKichan entstandenen Mittelmotor-Studie Chevrolet Monza GT von 1962.
Comm. 363
Fahrgestellnummer 254 557 374; Motornummer
54 S 0000465
17.7.1969 Auslieferung des Basisfahrzeugs Opel Diplomat B
7.1969 Erstzulassung auf die Adam Opel AG
Auf Grund des großen Erfolges der auf der IAA gezeigten Diplomat CD-Studie spielte Opel mit dem Gedanken die Studie zu einem straßentauglichen Fahrzeug weiterzuentwickeln. Die Kanzel sollte durch normale Türen ersetzt werden, und das Fahrzeug Stoßfänger, Scheibenwischer und ein seriennahes Diplomat-Armaturenbrett erhalten (Hrachowy 2000). Auch der ab 1970 amtierende Opel-Verkaufsvorstand (und heutige Entwicklungschef von Opels Konzernmutter General Motors) Robert „Bob“ A. Lutz war begeistert und wollte das Auto unter der Bezeichnung „Opel Strada“ vermarkten (Hrachowy 2000, Lichtenstein 2001). An Pietro Frua erging der Auftrag zur Überarbeitung der Idee und Anfertigung von zwei seriennaheren, fahrbereiten Prototypen (Hübner 1982, Hübner 1987, Oswald 1992, Griffith 1993, Günther 1996, Lichtenstein 2001).
13.11.1969 1:1 Konstruktionszeichnung (Dis. 863): „Disegno costruttivo Coupé 2 P su Opel 8 Cilidri (Argento Auteuil – Salchi)“
3/1970 Die Zeitschrift Quattroruote veröffentlichte bereits vor dem Genfer Salon eine Zeichnung
|
|
|
|
|
1970 Fotos des Studio Technico Pietro Frua
Merkmale: Lackierung silber (ital. Argento
Auteuil – Salchi), innen hellblaues Leder; 2+2-Sitzer, Radstand
gegenüber Diplomat B Serienmodell um 31,5 cm verkürzt, Kühlergrill mit
Mittelsteg und kleinen Nebelscheinwerfern, Opel-Emblem vor Motorhaube in
Chromring, Klappscheinwerfer, gläserne Heckklappe, Holzlenkrad
Verwendete Teile: Nebelscheinwerfer vom Opel GT, Türschlösser und -griffe
außen von Fiat, Türgriffe innen und Einstellrad Dreiecksfenster von BMW,
Heckleuchten vom Ford
15 M P6 (1966–1970), Leichtmetallräder von Campagnolo
|
|
|
|||
|
|
|
12.–22.3.1970 Präsentation auf dem Frua-Stand beim 40. Internationalen Automobilsalon in Genf (CH) gemeinsam mit dem bereits im Vorjahr gezeigten 1969 BMW 2800 GTS Coupé und dem 1969 Opel Admiral B Coupé
Max Stoop (Automobil Revue, Nr. 14, 20.3.1970, S. 2–3): „Ein silbergraues Coupé «Gran Turismo HS 8V» beherrscht als typische Frua-Schöpfung mit Fliessheck die Szene (Basis Opel Diplomat). Das Kühlergesicht gleicht mit seinen versenkten Scheinwerfern stark dem Opel-GT-Seriencoupé. Der reine Zweiplätzer ist mit hellblauen Sitzen versehen und besitzt die GM-Automatik mit Wählhebel auf der mittleren Konsole.“
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Auf dem Genfer Salon wurde von Frau eine Prospektmappe (Format DIN A4) mit drei Zeichnungen verteilt. Die erste davon ist von Opel Designchef Charles M. „Chuck“ Jordan signiert.
|
|
|
1.–11.10.1970 Präsentation auf dem Frua-Stand beim 57. Salon de l´Automobile in Paris (F) gemeinsam mit dem 1970 BMW 2002 GT4 Coupé (II)
ab diesem Zeitpunkt keine Kopfstützen mehr
Kuno Brunner (Automobil Revue, Nr. 43, 8.10.1970, S. 19): „Auf dem Stand von Frua war das vor Jahresfrist gezeigte, viersitzige Coupe auf der Mechanik des BMW TI sowie das Coupe HS 8V mit Motor und Fahrwerk des Opel Diplomat zu sehen.“
|
|
|
|
|
1970 1. Besitzer Adam Opel AG, Rüsselheim
Fotoaufnahmen mit dem Kennzeichen GG-DJ 730 (Dieses ist nicht im
Kraftfahrzeugbrief eingetragen.)
1971 Fotoaufnahmen mit dem roten Kennzeichen GG-04119
Kühlergrill geändert, ohne Nebelscheinwerfer
|
|
19.7. und 14.10.1971 Bericht im Kicker-Sportmagazin (Fehlhaber 1971a) und in der Automobil Revue (Fehlhaber 1971b). Der Frua CD soll in kleinen Stückzahlen gebaut werden und je nach Ausstattung zwischen 40.000 und 50.000 DM kosten.
|
|
Letzlich entschied man sich jedoch gegen die
Vermarktung des Frua CD unter der Marke Opel. Drei Gründe werden hierfür
genannt:
1. Pietro Frua verfügte nicht über die
entsprechenden Fertigungskapazitäten und bis zur Serienfertigung wäre noch
weitere technische Entwicklungsarbeit gemeinsam mit einem noch zu
findenden Karosseriehersteller (z.B. Maggiora
in Turin, die auch Fruas Maserati Mistral und später den Bitter SC
fertigten) erforderlich gewesen (Lichtenstein
2001). Laut Günther
(1996) war der Frua CD für eine Serienproduktion untauglich, was
nicht verwundert, da generell von einem Prototypen bis zu einer möglichen
Serienfertigung noch eine Fülle von Anpassungen erforderlich sind. Für
Großserienhersteller wie Opel kam allerdings meist auch nur die
Kooperation mit Karosseriebauern wie z.B. Pininfarina und Bertone in
Frage, die vom Design bis zur Serienfertigung alles aus einer Hand boten.
Pietro Frua konnte und wollte diese Art der
Dienstleitung nicht anbieten.
Bob Lutz erinnert sich (in einem Brief vom 6.4.1989 an Detlef
Lichtenstein, Berlin):
„Einige Jahre später (ca. 1969–70) heckten Pietro Frua und ich einen neuen Plan: Wir hätten gerne ein Opel Diplomat Coupé in begrenzter Serie gebaut, nach dem Vorbild des an der IAA mit Erfolg ausgestellten Diplomat CD Coupés. Frua baute einen oder zwei Prototypen mit Hilfe von Opel in der Form von Autos und/oder Bodengruppen sowie Motor und Getriebesätze. Leider aber zeigten sich bei diesem Projekt die Grenzen eines Betriebes von Fruas Größe: Er war ganz einfach außerstande, eine den Anforderungen eines Großherstellers entsprechende technische Leistung zu erbringen. Der Bau von Automobilen war leider bereits im Begriff, kompliziert zu werden.“
2. Für Opel war kein Volumenmodell zu erwarten, sondern nur ein
Imageträger. Für Opel wären die für eine wirtschaftliche Produktion
erforderlichen Stückzahlen nicht zu erreichen gewesen. (Hrachowy
2000)
3. General Motors hielt das Projekt für einen zu gefährlichen Konkurrenten
für den Chevrolet Corvette (Vintage
European Automobiles) und habe den Bau des Frua CD als Opel verboten
(Stange 1996; Hrachowy
2000, S. 31: Veto aus Amerika).
Stattdessen erteilte Opel grünes Licht zum Bau des Bitter
CD.
Ende
1971? Nutzung durch Charles M. Jordan
11/1971 Fahrbereicht in Road Test (CA, USA) (Sloniger
1971)
7.1.1972 Zulassung auf die Adam Opel AG, Rüsselsheim, mit dem Kennzeichen GG-D 4
10.1.1975 2. Besitzer Georg Deal Broomfield
Zulassung mit dem Kennzeichen WI-KX 474
Leichtmetallräder 6 J x 14 wie beim Bitter CD
neue Lackierung grün, Schweller silber, Heckabschlußblech schwarz; große
Nebelscheinwerfer vor Kühlergrill (dieser hierzu teilweise
ausgeschnitten); geändertes Opel-Emblem auf Motorhaube ohne umgebenden
Chromring, verchromter Außenspiegel an Fahrertür und zwei zusätzlich
mattschwarze Talbot-Spiegel auf Kotflügeln; zusätzliche V8-Embleme an
Kotflügeln
197x Karosseriereparatur nach schwerem Unfall, dabei Verstellmechanik der
Klappscheinwerfer entfernt und diese fest verschraubt
14.5.1976 3. Besitzer Walter Papenbrook (Mitarbeiter der Adam Opel AG),
Rüsselsheim
Zulassung im Landkreis Groß-Gerau mit dem Kennzeichen GG-P 394
|
|
|
|
|
5/1982 (68.000 km) Fahrbericht im Markt für klassische Automobile und
Motorräder (Hübner
1982)
innen schwarzes Leder, Zweispeichen-Lenkrad mit Prallfläche statt
Holzlenkrad
198x Lackierung rot (die ehemalige Außenseite der verschraubten Scheinwerferklappen ist nach wie vor grün), Talbot-Spiegel entfernt, Zierleisten an Schwellern entfernt, Luftaustrittslamellen hinter Seitenfenster schwarz, Heckabschlußblech schwarz
|
|
|
|
|
1989 Teilnahme bei der Bitter Club Rallye in Bad Dürkheim (D)
|
|
|
|||
|
|
1993 4. Besitzer: Wolfgang Krapp, Babenhausen (D)
13.4.1993 Zulassung im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit dem Kennzeichen
DA-V 8668
20.–23.5.1993 Teilnahme am 22. Internationalen Alt-Opel-Treffen in
Eisenach (D)
5/1993 Zulassung im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit dem Kennzeichen DA-U
8008
14.–15.8.1993 Ausstellung beim AvD
Oldtimer Grand Prix am Nürburgring (D)
|
|
|
|||
|
|
|
15.–16.7.1995 Teilnahme am 7. Britisch-Italienischen Klassikertreffen,
Bad König (D), Startnummer 89
1995 Teilnahme am Opel-Sonderkarosserie-Treffen in Sinsheim (D)
|
|
|
Wolfgang Krapp |
|
|
13.–14.7.1996 Teilnahme am 1. Internationalen Frua-Treffen in Bad König (D)
13.–16.5.1999 Teilnahme am 28. Internationalen Alt-Opel-Treffen in
Rüsselsheim (D)
Zulassung mit dem Kurzzeitkennzeichen DA-040235
|
|
|
|
|
3.–4.9.2005 Teilnahme an der Oldtimer-Gala – 4. Int. Concours d´Elegance in Schwetzingen (D)
2.–3.9.2006 Teilnahme an der Oldtimer Gala – 5.
European Concours d’Elegance in Schwetzingen (D), gemeinsam mit
dem 1964 Opel Kadett A Italsuisse Frua
Spider und dem 1969 Opel Admiral B Frua Coupé
14.6.2014 Teilnahme an der Alt-Opel
Jubiläumtour „50 Jahre KAD“; Fotos am Weingut Schloss
Westerhaus der Familie von Opel in Ingelheim am Rhein
11.–12.7.2015 ausgestellt im Rahmen der Sonderausstellung „Opel Diplomat
CD“ beim Klassikerfestival
in Bad König gemeinsam mit dem blauen
Opel Diplomat Frua CD (1974, Comm. 363/2), der 1969 Opel CD Stylingstudie
und dem 1969 Opel CD Sitzbock mit Gitterrohrkarosserie
2.–3.9.2017 Teilnahme an der Classic-Gala – 13. Int.
Concours d´Elegance in Schwetzingen (D)
|
|
1.9.2018 ausgestellt bei der Sonderkarosserie-Ausstellung der Alt-Opel Interessengemeinschaft von 1972 e.V. auf der Alt-Opel-Teilebörse in Rüsselsheim
|
|
|
|
30.6.2019 Teilnahme am 19. Klassikertreffen an den Opel-Villen, Rüsselsheim, gemeinsam mit dem 1969 Opel Admiral B Frua Coupé
|
|
|
|
Comm. 363/2
Fahrgestellnummer 254 557 373 (sowie auf dem deutschen Typenschild: TPD 76012); Motornummer 54 S 0000479
22.6.1969 Auslieferung des Basisfahrzeugs Opel Diplomat B
9.1969 Erstzulassung in Deutschland (persönliche Mitteilung der Adam Opel AG vom 17.5.2002)
Merkmale: vordere Stoßstange durchgehend und schmaler; Motorhaube mit Luftschlitzen vorn mittig und hinten seitlich; kein Opel-Emblem vor Motorhaube; hinteres Seitenfenster länger; 4 statt 3 Entlüftungsschlitze hinter hinterem Seitenfenster; Fensterlinie hinter der B-Säule stärker ansteigend; doppelte Rückleuchteneinheiten; Leichtmetallräder 6½ J x 14 von Campagnolo (wie später beim Bitter CD)
|
|
|
|
|
Nachdem die Entscheidung gegen die
Vermarktung unter der Marke Opel gefallen war, blieb das zweite,
blaue Fahrzeug zunächst im Besitz von Pietro Frua.
14.–24.3.1974 Ausstellung auf dem Frua-Stand beim 44. Internationalen
Automobilsalon in Genf (CH) gemeinsam mit dem
1974 Audi 100 S Mittelmotor-Coupé. Die Produktion des Bitter
CD hatte zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen. Vermutlich wollte
Frua nur noch einen Käufer für den Prototypen finden.
|
|
|
|
|
25.4.–5.5.1974 Ausstellung auf dem 16. Salón Internacional del Automóvil de Barcelona (E) gemeinsam mit dem Maserati Quattroporte „Aga Khan“ (1971); Teilnahme beim Desfile de Elegancia en Automovil; Startnummer 47
|
|
|
|
Erst 1976 (nicht 1975, wie von Lichtenstein 2001 angegeben) gelangte der blaue Frua CD durch Vermittlung des Opel-Designers Karl-Heinz Wedel nach Deutschland (Darmstädter Echo vom 29.11.1993).
1976 1. Besitzer Emil Hartmann (Opel Autohaus Darmstadt), Darmstadt (D)
8.3.1976 Zulassung in mit dem Kennzeichen DA-EV 841
27.11.1993 zum
Verkauf angeboten auf Henry´s-Auktion
in Darmstadt; das telefonische Höchstgebot von 45.000 DM erreichte jedoch
nicht das Limit von 57.500 DM
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
ca. 1996 2. Besitzer Ullrich Brass (Geschäftsführer Opel
Brass Niederlassung Darmstadt), Aschaffenburg
13.–14.7.1996 Teilnahme am 1. Internationalen Frua-Treffen in Bad König
(D)
|
|
|
|
|
|
– Rückleuchten: Ford 15M (Baureihe P6, 9/1966–8/1970)
1971 David R. „Dave“ Holls (Opel Designchef seit 7/1971; vorher Assistent
seines Vorgängers Charles
M. „Chuck“ Jordan) ermutigt Erich Bitter zum Bau des Bitter CD (Günther
1996, Hrachowy
2000); Gründung der Bitter
Automobil GmbH & Co. KG in Schwelm
Design: Laut Herbert Killmer (Interview durch Joachim
Stange) handelte es sich beim Bitter CD um eine vom Frua CD
unabhängige Parallelentwicklung. Nach anderen Quellen wurde von den
Opel-Designern Pietro Fruas Prototyp überarbeitet
(Lichtenstein
2001). Dave Holls hatte den Frua CD wie andere Opel Manager oft
gefahren, Erich Bitter hatte das Fahrzeug oft gesehen (Griffith
1993). Ein Vergleich der Fahrzeuge zeigt die Einflüsse des Opel CD
und des Frua CD auf den Bitter CD. Die grundsätzlichen Änderungen des Frua
CD gegenüber Opel CD von 1969 finden sich beim Bitter CD wieder:
2+2-Sitzer, gerade abgeschnittenes Heck. Erich Bitter zeichnete einige
Entwürfe basierend auf dem Frua CD, bevor er sich für die späteren
Stilelemente entschied: vorversetzte Windschutzscheibe und eine kantigere
Form mit markanter Gürtellinie und wenig Chrom (Griffith
1993). Dave Holls und sein Team ergänzten den kleinen Fontspoiler,
den größeren Kühlergrill, setzten die Stoßstangen höher und verlängerten
die Unterkante der hinteren Seitenfenster bis zur Heckscheibe (Griffith
1993). Holls Assistent George Gallion stellte Erich Bitter ein
1:5-Modell zur Verfügung (Hrachowy
2000), das Opel strömungsdynamisch getestet hatte (Griffith
1993). Letzte gestalterische Hand legte Dave Holls selbst an (Günther
1996). Herbert Killmer sagte zur Entwicklung des Designs des Bitter
CD durch Opel (im Interview durch Joachim
Stange): „Wir haben unsere Ideen verwirklicht und zumindest Erich
Bitter teilweise glauben lassen, die Ideen kämen von ihm.“
Die Fahrwerkabstimmung und Fahrerprobung auf dem Opel-Testgelände in
Dudenhofen wurde von der Adam Opel AG durchgeführt. Die
Belastungsprüfungen und simulierten Dauerfahrtests wurden von Erich Bitter
initiiert und auf dem Hydropulser bei Baur in Stuttgart durchgeführt. (Hrachowy
2000).
Das Team um Baur-Chefkonstrukteur Hermann Wenzelburger leistete auch
darüber hinaus erhebliche konstruktiven und produktionstechnische
Entwicklungsarbeit (Günther
1996, Hrachowy
2000) inklusive dem Bau eines Hartschaummodells (Hrachowy
2000).
13.–23.9.1973 Präsentation des Bitter CD auf dem Opel-Stand auf der
45. Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt/Main (D)
Merkmale: Radstand des Diplomat B um nur 16,4 cm auf 2.680 mm verkürzt,
Fahrzeuglänge 4.855 mm, Unterkante der hinteren Seitenscheiben bis zur
Heckscheibe ausgezogen
Ende 1973 (Hrachowy
2000: S. 45) Produktionsbeginn des Bitter CD bei der Baur Karosserie
und Fahrzeugbau GmbH, Stuttgart
Der Vertrieb erfolgte über 25 ausgewählte Opel-Händler. Kaufpreis 1974:
58.400 DM, 1978: 67.574 DM
Anfang 1980: Produktionsende des Bitter CD (Hrachowy
2000: S. 76)
Gesamtfertigung 395 Stück (1973: 6,
1974: 99, 1975: 79, 1976: 73, 1977: 71,
1978: 30, 1979: 37), von denen 1999 noch ca. 160 existieren (Hrachowy
2000); sowie 5 Rohkarosserien für das Lager (Frank O. Hrachowy,
persönliche Mitteilung 23.5.2002).
|
Basisfahrzeug |
Opel Diplomat B V8 |
|
Motor |
vornliegender, wassergekühlter Chevrolet „small block“ V8-Motor; Block und Kopf aus Grauguss; durch Doppelrollenkette angetriebene, zentrale untenliegende Nockenwell; durch Stößelstangen und Hydrostößel angetriebene, hängende Ventile (ohv); 1 Doppelregistervergaser (Rochester Quadra-jet) |
|
Bohrung x Hub |
101,6 x 82,6 mm, Kompressionsverhältnis 10,5:1 |
|
Hubraum |
5.354 cm³ |
|
Leistung |
230 DIN-PS (= 169 kW) bei ca. 4.700 U/min |
|
max. Drehmoment |
43,5 mkg (DIN) (= 435 Nm) bei 3.100 U/min |
|
Leistungsgewicht |
7,0 kg/PS |
|
Kraftübertragung |
automatisches Getriebe „Turbo-Hydra-Matic“ mit hydraulischem Drehmomentwandler und Dreigang-Planetenradsystem, geteilte Kardanwelle, Hinterradantrieb |
|
Vorderachse |
Einzelradaufhängung mit doppelten Trapez-Dreiecksquerlenkern und Schraubenfedern und hydraulischen Teleskop-Stoßdämpfern, Drehstabstabilisator, Kugelumlauflenkung mit Servohilfe |
|
Hinterachse |
starre De-Dion-Achse mit zwei Längs- und einem Dreiecksquerlenker, Doppelgelenk-Antriebswellen, Schraubenfedern, hydraulischen Teleskop-Stoßdämpfern und Drehstabstabilisator |
|
Bremsen |
hydraulisch betätigte Zweikreis-Vierradbremse mit Bremskraftverstärker, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten |
|
Karosserie |
selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
|
Länge x Breite x Höhe |
4.490 x 1.710 x 1.180 mm; Radstand: 2.530 mm |
|
Leergewicht |
1.600 kg |
|
Höchstgeschwindigkeit |
220 km/h; Beschleunigung 0–100 km/h: 8,7 Sekunden (Hübner 1982) (vgl. jedoch Diplomat B V8 und Bitter CD: Beschleunigung 0–100 km/h: 10 Sekunden) |
|
Verbrauch |
(Basismodell: 13,8 Liter Super pro 100 km) |
|
Bauzeit |
1970 |
|
Stückzahl |
2 |
|
Copyright © 2001–2024 Registro
Pietro Frua | Alle Rechte
vorbehalten | Impressum | Letzte
Änderung: 6.2.2021 |